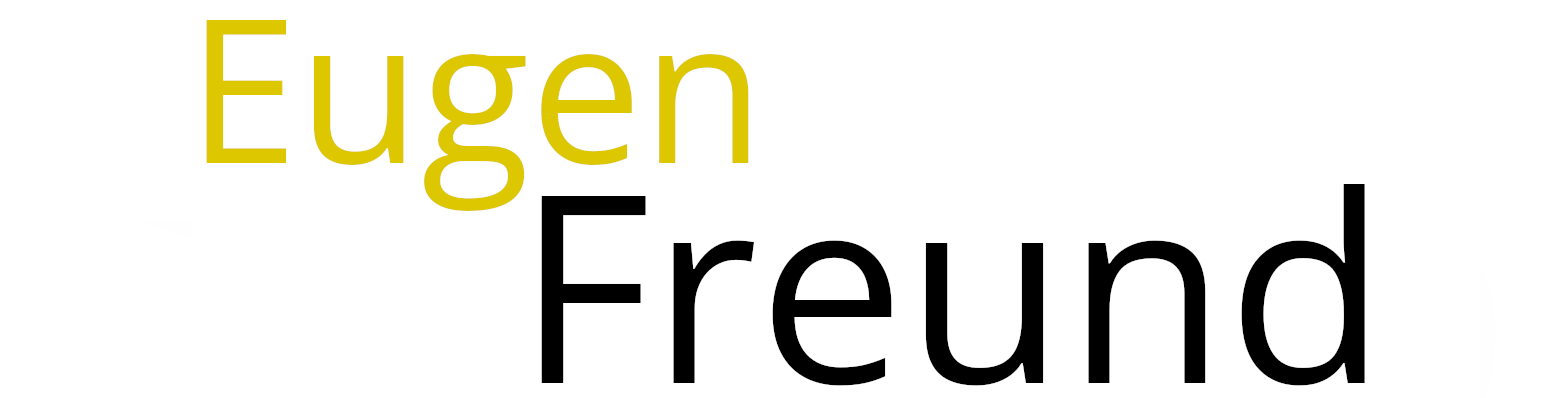Werden die Karten im US-Wahlkampf neu gemischt?
Von Eugen Freund
Der amerikanische Präsident ist schon ziemlich alt. Trotz zahlreicher Herausforderungen hat er die erste Amtszeit gut hinter sich gebracht. Die Wirtschaft hat sich erholt, die Inflation ging zurück, der Machthaber im Kreml ist zwar immer noch der Feind Nummer Eins, doch die Konflikte, in die Moskau verwickelt ist, bedrohen nicht die USA selbst. Der Mann im Weissen Haus, obwohl er der älteste Präsident in der Geschichte ist, stellt sich für die nächste Periode zur Verfügung. Nur ich glaube nicht daran: ich hatte damals in den 1980er Jahren – die Rede ist also von Ronald Reagan – von seiner Wahl gegen Jimmy Carter, über das Schussattentat, das ihn schwer verletzte, bis zu seinem Wutausbruch über die Sowjetunion („Der Kommunismus gehört auf den Misthaufen der Geschichte“) die Amtszeit Reagans hautnah miterlebt, als Österreicher in New York. Ich versäumte keine politische Talk-Show, keinen „live“-Auftritt des Präsidenten, was insofern erleichtert wurde, als CNN damals gerade aus der Taufe gehoben wurde und jede relevante (oder auch irrelevante) Rede Ronald Reagans direkt über das Kabelfernsehen übertrug. Ich glaubte, nicht zuletzt auch durch die tägliche Lektüre einflussreicher US-Tageszeitungen, einen guten Einblick in die US-Politik bekommen zu haben. Und trotzdem legte ich mich fest: Reagan würde nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidieren. Mein Hauptargument: er habe (sich) bewiesen, dass er, der „B-Movie-Schauspieler“, durchaus zu größerem in der Lage ist, dass er eben die mächtigste Militärmacht der Erde mit starker Hand führen könne. Nun aber, als 73-jähriger, könne er sich, zufrieden und stolz auf das Erreichte, auf seine Ranch in Kalifornien zurückziehen. Wie wir wissen, kam es ganz anders: ein haushoher Sieg über den Demokraten Walter Mondale katapultierte Reagan ein weiteres Mal ins Weisse Haus.

Was das alles mit Joe Biden zu tun hat? Nun, wie bei Ronald Reagan gehen auch heute alle davon aus, dass sich Biden für eine zweite Amtszeit bewirbt. Wobei „davon ausgehen“ ohnehin untertrieben ist, Biden hat ja derartiges schon offiziell angekündigt. Und dennoch halte ich es für möglich, nein, sogar für wahrscheinlich, dass alles noch ganz anders kommen kann. Also wage ich mich mit einer Prognose weit aus dem Fenster: in den nächsten sechs Monaten wird der US-Präsident seine Kandidatur wieder rückgängig machen. Das wäre keineswegs einmalig. Dazu muss ich allerdings noch etwas tiefer in die US-Geschichte greifen. Lyndon B. Johnson hatte nach der Ermordung John F. Kennedys in Dallas am 22. November 1963 das Präsidentenamt übernommen. Er war – wie sein späterer Nachnachnach…-Folger Joe Biden – ein Vollblutpolitiker. Schon als 29-jähriger zog er in das US-Repräsentantenhaus ein, ein Jahrzehnt später wurde er Senator, bevor ihn Kennedy als seinen „Running-mate“ für die Wahlen im Jahr 1960 in sein Ticket aufnahm. Johnson hatte den Vietnam-Krieg seiner Vorgänger geerbt, war aber innenpolitisch ein Revolutionär. Er erweiterte die Bürgerrechte für die afro-amerikanische Bevölkerung, erleichterte den Zugang zu Medikamenten und ärztlicher Behandlung („Medicare und Medicaid“), führte einen „Krieg gegen die Armut“ und verschärfte sogar das Waffengesetz. Doch die Stimmung in der Bevölkerung kippte, der Gegenwind, vor allem wegen seiner Vietnam-Politik, wurde schärfer. Und trotzdem waren die meisten politischen Beobachter überrascht, als er am 31. März 1968, sieben Monate vor der Wahl, ankündigte, nicht mehr zu kandidieren.
Nochmals: Was hat das alles mit Joe Biden zu tun? Biden ist achtzig. ER ist jetzt der bei weitesten älteste Präsident, den die USA je an der Spitze hatten. Was seine Bilanz betrifft, kann sie sich sehen lassen: er hat das Land zielsicher durch schwierige Zeiten geführt. Vor allem machte er die fragwürdigen Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig: die USA sind dem Klimaschutzabkommen von Paris wieder beigetreten, Washington ist wieder Mitglied der Weltgesundheitsorganisation, ein riesiges Konjunktur-Programm wurde auf den Weg gebracht, die Ukraine wird mit Milliarden von Steuergeldern in ihrem Kampf gegen den russischen Einmarsch unterstützt. Und beim mörderischen Angriff auf Israel durch die Hamas-Terroristen zeigte Biden Haltung: er flog sofort zu seinem engsten Verbündeten in den Nahen Osten, obwohl er mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nicht in bestem Einvernehmen war. Trotz aller Verfahren, die auf seinen Gegner Donald Trump jetzt warten, liegt der (vermutliche) republikanische Präsidentschaftskandidat einige Punkte vor Biden
Nicht zuletzt, weil Joe Biden die Unterstützung der Basis verliert. Die Mehrheit in seiner Partei hält ihn einfach für zu alt. Da ist es auch nicht hilfreich, dass Biden gelegentlich stolpert (sowohl dialektisch als auch physisch), und das vor allem von seinen Gegnern in den sozialen Medien genüsslich verbreitet wird. Bei seinen offiziellen Aufritten liest er zwar beinahe fehlerfrei vom Teleprompter, doch oft so vernuschelt, dass man ihn kaum versteht. Auffällig ist auch, dass er bei jedem Besuch im Oval Office auf vorbereitete Zettel angewiesen ist. Freie, spontane Reden hört man von ihm selten. In den TV-Duellen gegen Donald Trump wird er blitzschnell reagieren müssen, da kann er sich nicht auf schriftliche Unterlagen stützen. Von den anstrengenden Wahl-Reisen quer durchs Land ganz zu schweigen. Wenn sich die Demokraten und Joe Biden dieser Realität nicht stellen, verlieren sie ein Rennen, das sie gegen diesen Donald Trump einfach nicht verlieren dürften.
Irgendwann in den nächsten Monaten wird diese Erkenntnis auch dem Präsidenten dämmern. Oder ich habe – zum zweiten Mal in vierzig Jahren – unrecht.
P.S. Gegen diese – zugegeben mutige – These spricht vor allem eines: weit und breit ist kein demokratischer Politiker in Sicht, der das mit sich bringt, was in den USA „name recognition“ genannt wird, also einen landesweiten Bekanntheitsgrad.
.